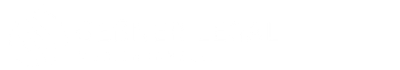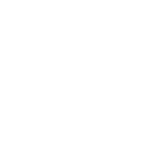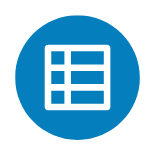Markenrechtliche Abgrenzungsvereinbarung: kostengünstig und effektiv
Die Bedeutung der Marke wird in einer modernen und auf Konsum ausgelegten Marktwirtschaft für Unternehmen immer wichtiger. Durch sie wird vielfach die Zuordnung bestimmter Waren oder Dienstleistungen zu einem bestimmten Unternehmen als Hersteller (sog. Herkunftsfunktion) ermöglicht. Aufgrund der hohen wirtschaftlichen Bedeutung kommt es vielfach zu Auseinandersetzungen zwischen Markenrechtsinhabern. Eine Möglichkeit der friedlichen und weniger kostenintensiven Streitbeilegung stellt die sog. markenrechtliche Abgrenzungsvereinbarung (bzw. Koexistenzvereinbarung) dar.
Einführender Beispielsfall
A betreibt einen Obsthandel. Für die entsprechenden Nizza-Klassen hat er sich eine Marke eintragen lassen. Auch B handelt mit Obst und hat sich eine entsprechende Marke eintragen lassen. Eine Recherche des B ergibt, dass beide Marken eine überdurchschnittliche Zeichen- sowie Warenähnlichkeit aufweisen, so dass eine Verwechslungsgefahr besteht. Während A als Großhändler nur Wiederverkäufer in Westdeutschland beliefert, betreibt B ein kleines Ladengeschäft in einer Stadt in Ostdeutschland und verkauft in kleineren Mengen nur unmittelbar an Endverbraucher. B befürchtet nun, dass A aus seiner prioritätsälteren Marke gegen ihn markenrechtliche Ansprüche geltend macht.
Vorliegend besteht aufgrund der Zeichenähnlichkeit und Branchennähe eine gewisse Gefahr, dass A wegen bestehender Verwechslungsgefahr Unterlassungsansprüche gegen B geltend macht, obwohl beide unterschiedliche Verkehrskreise in unterschiedlichen Regionen ansprechen und sich deshalb sehr wahrscheinlich nicht gegenseitig behindern würden. Eine Möglichkeit diese Gefahr zu beseitigen, wäre eine markenrechtliche Abgrenzungsvereinbarung zwischen A und B.
Inhalt der markenrechtlichen Abgrenzungsvereinbarung
Die markenrechtliche Abgrenzungsvereinbarung stellt eine rechtsgeschäftliche bzw. vertragliche Regelung der Benutzung von kollidierenden Markenrechten zwischen verschiedenen Markenrechtsinhabern dar.[2] Dabei werden die Schutzbereiche der betroffenen Marken voneinander so genau wie möglich vertraglich – und im besten Fall schriftlich – abgegrenzt.
Für den Beispielsfall würde dies bedeuten, dass A und B vertraglich vereinbaren, dass A die Marke nur für den Verkauf von Obst an Wiederverkäufer (B2B) benutzt, während B seine Marke nur für den Verkauf von Obst im stationären Einzelhandel an den Endverbraucher verwendet.
Eine örtliche Abgrenzung ließe sich insoweit vereinbaren, als dass der A ausschließlich Wiederverkäufer in Westdeutschland beliefert, während der Verkauf im Ladengeschäft des B unter der Marke nur in Ostdeutschland stattfindet.
Abgrenzung zu anderen Instituten
Allerdings ist die markenrechtliche Abgrenzungsvereinbarung nicht die einzige Möglichkeit die Gefahr eines Widerspruchs zu beseitigen. Weitere Möglichkeiten stellen die Vorrechtserklärung, die Nichtangriffsabrede und ein entsprechender Markenlizenzvertrag dar. Wie die markenrechtliche Abgrenzungsvereinbarung von den übrigen Instituten abzugrenzen ist, soll im Folgenden kurz dargestellt werden.
Abgrenzung zur Vorrechtserklärung
Die Vorrechtserklärung wird teilweise als Synonym für die markenrechtliche Abgrenzungsvereinbarung verwendet. Häufig enthält die Abgrenzungsvereinbarung nämlich gerade eine Klausel die inhaltlich einer Vorrechtserklärung gleicht. Von einer Vorrechtserklärung wird regelmäßig dann gesprochen, wenn sich lediglich eine Partei zu Einschränkungen der Benutzung ihrer Marke verpflichtet.
Abgrenzung zur Nichtangriffsabrede
Gleiches gilt auch für eine etwaige Nichtangriffsabrede. Auch diese ist häufig Bestandteil einer Abgrenzungsvereinbarung. Dabei wird regelmäßig vereinbart, dass die Markeninhaber die Marke des jeweils anderen nicht mit Mitteln des Markenrechts (Widerspruch, Löschungsantrag, Unterlassungs- oder Schadensersatzansprüchen) angreifen.
Abgrenzung zum Markenlizenzvertrag
Anders als bei der Vorrechtserklärung und der Nichtangriffsabrede ist hingegen eine Abgrenzung zwischen einem Markenlizenzvertrag und einer Abgrenzungsvereinbarung trennscharf möglich. Denn während ein Lizenzvertrag überhaupt erst Nutzungsrechte an Markenrechten einräumt, ist es für die Abgrenzungsvereinbarung notwendig, dass beide Parteien bereits Inhaber von kollidierenden Markenrechten sind.
Zwar kann eine markenrechtliche Abgrenzungsvereinbarung durchaus eine Zustimmung für eine bestimmte Benutzungshandlung des Inhabers des prioritätsjüngeren Anmelders beinhalten. Dies ist jedoch nicht als eine Art der Lizenzierung, sondern vielmehr als Duldung zu verstehen.
Was sollte in einer Abgrenzungsvereinbarung geregelt werden?
Welchen Inhalt die Abgrenzungsvereinbarung im Detail hat oder haben soll, hängt von den Umständen des Einzelfalls ab. In den Grenzen des allgemeinen Vertragsrechts sind die Vertragsparteien nach dem Grundsatz der Vertragsfreiheit weitestgehend frei in ihrer Entscheidung, was geregelt werden soll. Dabei haben sich aber gerade mit Blick auf die Abgrenzungsvereinbarung im Markenrecht bestimmte Klauseln als zweckmäßig erwiesen:
Nennung der Vertragsparteien und der Markenrechte
Wie in jedem Vertrag, sollten zunächst die Parteien so genau wie möglich bezeichnet werden. Dabei gilt es besonders bei der Parteibezeichnung darauf zu achten, wer tatsächlich Inhaber des jeweiligen Markenrechts ist.
Darüber hinaus müssen ebenfalls die kollidierenden Markenzeichen so genau wie möglich beschrieben werden. Insbesondere ist die jeweilige Anmelde- bzw. Registernummer und zumindest bei Wortmarken noch der Wortlaut des jeweiligen Kennzeichens mit aufzunehmen.
Abgrenzungsklausel im engeren Sinne
Der wichtigste Bestandteil einer Abgrenzungsvereinbarung ist die Abgrenzungsvereinbarung bzw. -klausel als solche. Diese kann unterschiedlich aussehen und ist an den konkreten Einzelfall anzupassen.
Zunächst ist denkbar, dass die Parteien schlichtweg vereinbaren, dass sie jeweils nur innerhalb bestimmter Regionen verkaufen.
Für den obigen Beispielsfall würde dies bedeuten, dass beispielsweise vereinbart wird, dass A nur in Westdeutschland und B nur in Ostdeutschland ihr Obst verkaufen und sich hierdurch nicht gegenseitig behindern.
Eine zweite denkbare Variante besteht darin, dass zwischen den Parteien eine Beschränkung des Kennzeichenschutzes innerhalb einer Waren- oder Dienstleistungsklasse vereinbart wird.
Bsp.:
Nimmt man an, dass die Inhaber der kollidierenden Marken Bekleidung (Nizza-Klasse 25) verkaufen, so kann vereinbart werden, dass Vertragspartner B seine Marke nur für „Kinderkleidung“ verwendet und damit beschränkt.
Nichtangriffsklausel
Häufig findet sich in einer Abgrenzungsvereinbarung auch eine entsprechende Nichtangriffsklausel. Hierbei verpflichtet sich zumeist die Vertragspartei mit der prioritätsjüngeren Marke gegenüber der anderen Vertragspartei, keine Ansprüche geltend zu machen, wenn die andere Vertragspartei ähnliche Marken neu anmeldet oder benutzt.
Rücknahme von Rechtsbehelfen, soweit eingelegt
Wie bereits dargelegt, dient die Abgrenzungsvereinbarung zumeist der gütlichen Streitbeilegung. Dies kann in verschiedenen Verfahrensstadien geschehen. Hat der Inhaber der prioritätsälteren Marke beispielsweise gegen die Anmeldung einen Widerspruch eingelegt, so verpflichtet sich die widersprechende Partei regelmäßig zur Rücknahme des Widerspruchs.
Wurde bereits eine Verletzungsklage erhoben, so kann die Verpflichtung enthalten sein, diese zurückzunehmen.
Geltungsbereich der Vereinbarung
Darüber hinaus sollte auch der Geltungsbereich der Abgrenzungsvereinbarung festgelegt werden. Der Geltungsbereich der Abgrenzungsvereinbarung hängt regelmäßig mit dem Geltungsbereich des Zeichenrechts zusammen. Handelt es sich um deutsche Marken, so ist der Geltungsbereich Deutschland. Handelt es sich um Unionsmarken, so ist der Geltungsbereich der Abgrenzungsvereinbarung in aller Regel die Europäische Union. Der Geltungsbereich sollte insbesondere dann auf andere Länder ausgeweitet werden, wenn bereits absehbar ist, dass eine der Vertragsparteien künftig auch in diesem Land die Marke anmelden möchte.
Kostentragung
Zudem handelt es sich bei der Abgrenzungsvereinbarung um eine gütliche Einigung des Rechtsstreits, aus der beide Parteien Vorteile ziehen. Damit scheint es sachgerecht, die Kosten ebenfalls zwischen den Parteien aufzuteilen bzw. so zu regeln, dass jeder seine eigenen Kosten zu tragen hat. Dies gilt nicht nur für die Kosten im Zusammenhang mit einem etwaigen Widerspruchsverfahren, sondern ggf. auch für die Rechtsanwaltskosten die im Zusammenhang mit der Abgrenzungsvereinbarung entstehen.
Rechtsfolgen bei Rechtsnachfolge
Schließlich erscheint es auch sinnvoll, eine Klausel in den Vertrag mit aufzunehmen, die die Verpflichtungen aus der Abgrenzungsvereinbarung bei Rechtsnachfolge oder Unterlizenzierung regelt. Denn wie bereits angeklungen ist, gilt die Abgrenzungsvereinbarung als schuldrechtlicher Vertrag nur zwischen denjenigen Parteien, die die Vereinbarung treffen.
Sachgerecht erscheint es daher, die Parteien auch im Verhältnis zu Dritten (Lizenznehmern und Rechtsnachfolgern) zu verpflichten, die Dritten entsprechend der Abgrenzungsvereinbarung zu verpflichten. Dies kann wiederum durch entsprechende Klauseln in den Lizenzverträgen erfolgen.
Rechtsfolgen
Die konkreten Rechtsfolgen richten sich nach den von den Parteien in der Abgrenzungsvereinbarung getroffenen jeweiligen Pflichten. Sollte eine Nichtangriffsabrede Teil der Abgrenzungsvereinbarung sein, so verpflichten sich die Parteien gegenseitig die Marke des jeweils anderen nicht anzugreifen.
Enthält die Abgrenzungsvereinbarung beiderseitige Pflichten, so hat sie regelmäßig den Charakter eines Vergleichs.
Vorteile einer Abgrenzungsvereinbarung
Die Vorteile einer Abgrenzungsvereinbarung liegen auf der Hand. Zunächst stellt die Abgrenzungsvereinbarung eine Möglichkeit dar, einen Rechtsstreit entweder präventiv zu verhindern oder einen bereits begonnenen Rechtsstreit – ähnlich wie ein klassischer Vergleich – gütlich zu beenden. Zwar ist auch der Rechtsschutz im Wege der einstweiligen Verfügung schon schneller zu erreichen als im klassischen Klageweg. Wie aber der Name schon sagt, regelt die einstweilige Verfügung einen Zustand nur einstweilig und nicht endgültig, so dass sich häufig ein klassisches Hauptverfahren anschließt.
Dabei nicht unerheblich ist natürlich auch der Kostenvorteil. Wird ein Rechtsstreit eingeleitet und abgeschlossen, so sind die Kosten regelmäßig höher, als wenn der Rechtsstreit außergerichtlich beigelegt wird.
Kartellrechtliche und wettbewerbsrechtliche Grenzen
Nicht selten sind Inhaber kollidierender Marken zugleich auch Wettbewerber. Dies häufig schon deshalb, weil eine Markenkollision häufig aufgrund der Ähnlichkeit angebotener Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke eingetragen und geschützt ist, vorliegt.
Schließen sich nun zwei Wettbewerber zusammen, indem sie einen bestimmten Markt mit Bezug auf die Verwendung der kollidierenden Marken unter sich aufteilen, so könnte dies eine verbotene Kartellabsprache darstellen. Solche Absprachen werden durch das deutsche (§ 1 GWB) wie auch das europäische Recht (Art. 101 Abs. 1 AEUV) untersagt und können durch die zuständigen Behörden mit empfindlichen Geldbußen sanktioniert werden.
Der EuGH hat einst festgelegt, wann eine Abgrenzungsvereinbarung jedenfalls nicht kartellrechtswidrig ist. Nämlich dann, wenn der Regelungsgehalt der Abgrenzungsvereinbarung nicht über den Inhalt des Unterlassungsanspruchs des Inhabers des prioritätsälteren Markenrechts hinaus geht.
Auswirkungen auch auf Rechtsnachfolger?
Für die Beantwortung der Frage, ob eine Abgrenzungsvereinbarung auch für und gegen einen Rechtsnachfolger gilt, ist festzuhalten, dass es sich bei der Abgrenzungsvereinbarung um einen schuldrechtlichen Vertrag handelt. Ein solcher gilt grundsätzlich nur zwischen den Vertragsparteien („inter partes“).
Dies kann in solchen Fällen zu Problemen führen, in denen der eine Markeninhaber seine Rechte aus der Marke gem. § 27 MarkenG auf einen Dritten überträgt. Die Verpflichtungen aus der Abgrenzungsvereinbarung gehen nach Rechtsprechung des BGH nicht ohne weiteres auf den Rechtsnachfolger über.
Fazit
Die Abgrenzungsvereinbarung ist ein einfaches und kostengünstiges Mittel, eine markenrechtliche Auseinandersetzung (Widerspruch, Löschung, Verletzungsklage) zu vermeiden oder einen bereits bestehenden Verletzungsprozess zu beenden.
Ihre Anwälte für Markenrecht
Wenn auch Sie als Unternehmer Fragen rund um das Markenrecht, Lizenzverträge, Abgrenzungsvereinbarungen oder die Durchsetzung oder Abwehr von Unterlassungs-, Auskunfts- oder Schadensersatzansprüche haben, dann kontaktieren Sie uns gerne. Als Fachanwaltskanzlei für gewerblichen Rechtsschutz sind wir auf das Markenrecht spezialisiert. Unsere Vertretung erfolgt bundesweit.
Beitragsbild: © Olivier Le Moal/AdobeStock