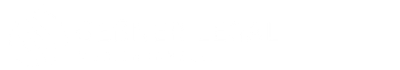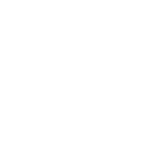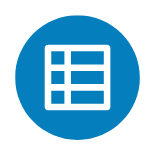Die Verwechslungsgefahr im deutschen und europäischen Markenrecht
Die Marke ist aus unserer Welt kaum noch wegzudenken. Ihr wirtschaftlicher Wert ist im geschäftlichen Verkehr für Firmen und Unternehmen mit Blick auf das Marketing und die Kundenbindung sehr hoch und sie begegnen uns über den Tag fast überall – egal ob in der analogen oder digitalen Welt. Ein wichtiger, zu beachtender Aspekt, ist die Verwechslungsgefahr im Markenrecht.
Funktionen der Marke
Grund hierfür ist die Funktion der Marke. Diese hat viele Funktionen, sowohl wirtschaftlicher als auch rechtlicher Natur. Die wichtigste Funktion ist jedoch die Herkunftsfunktion. Dies kann bereits der Definition des rechtlichen Begriffs „Marke“ entnommen werden. Denn eine Marke ist ein Zeichen, durch das Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens von den Waren und Dienstleistungen eines anderen Unternehmens abgegrenzt bzw. unterschieden werden können (vgl. § 3 Abs. 1 MarkenG).
Damit soll für die Kunden eines Produkts oder einer Dienstleistung auf den ersten Blick erkennbar werden, aus welchem Unternehmen die Ware / Dienstleistung kommt. Darüber hinaus werden der Marke vor allem ökonomische Funktionen, wie die Werbefunktion oder Garantiefunktion zugesprochen. Diese sind bislang aber nicht als rechtliche Markenfunktionen im engeren Sinne, sondern ausschließlich in einem ökonomisch-wirtschaftlichen Sinn erfasst.
Anm.: Mit der UWG-Novelle 2022 soll es künftig untersagt werden, dass ein Unternehmen Waren unterschiedlicher Qualitäten unter derselben Marke in unterschiedlichen EU-Mitgliedstaaten identisch vertreibt (also z.B. unter derselben Marke). Inwieweit hierdurch nunmehr eine Garantiefunktion der Marke auch im rechtlichen Sinne anerkannt wird, bleibt abzuwarten.
Markenschutz als gewerbliches Schutzrecht
Weil die Kunden mit den Produkten oder Dienstleistungen eines bestimmten Herstellers oder Unternehmens eine besondere Qualität verbinden und deshalb die Produkte eines Herstellers lieber kaufen als die eines anderen Herstellers, hat die Marke als Wiedererkennungssymbol eine wirtschaftlich wichtige Funktion für die Unternehmen. Deshalb besteht die Möglichkeit, entsprechende (Kenn-)Zeichen vor allem durch Eintragung in die Markenregister zu schützen.
Nationale Marke oder Unionsmarke?
Wegen der voranschreitenden Globalisierung und des internationalen Warenverkehrs – insbesondere innerhalb der Europäischen Union – gibt es eine Zweigleisigkeit des Markenrechts als Teil des gewerblichen Rechtsschutzes. Zum einen gibt es die nationalen Markenämter, wie es in Deutschland das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA) ist. Meldet man die Marke beim DPMA an, so handelt es sich um eine deutsche / nationale Marke, die auch nur Schutz innerhalb des deutschen Staatsgebietes entfaltet.
Davon zu unterscheiden ist die Anmeldung einer Marke beim Amt der Europäischen Union für Geistiges Eigentum (EUIPO). Insoweit handelt es sich um eine sogenannte Unionsmarke, deren Schutz sich auf den gesamten Europäischen Binnenmarkt erstreckt. Natürlich ist es ebenfalls denkbar, dass eine Marke sowohl in ein nationales Markenregister, als auch in das Markenregister der EUIPO eingetragen wird.
MarkenG und UMV als Rechtsgrundlagen
Eng mit der Frage der Art der Marke ist die Frage nach der anwendbaren Rechtsordnung verknüpft. Hierbei spielt die Art der angemeldeten Marke eine wesentliche Rolle.
Bei Nationaler Marke: MarkenG
Bei einer beim DPMA angemeldeten nationalen Marke findet das deutsche Markengesetz Anwendung. Dem Schutz des Markengesetzes zugänglich sind eine Vielzahl von Markenarten. Geschützt werden können nach § 3 Abs. 1 MarkenG insbesondere Wörter, Personennamen, Abbildungen, Buchstaben, Zahlen, Klänge, dreidimensionale Gestaltungen, Farben und Farbzusammenstellungen. Wie der Gesetzestext aber verdeutlicht („insbesondere“) ist die Aufzählung nicht abschließend. Vielmehr kann nahezu jede Art von Zeichen geschützt werden, so lange es zur Unterscheidung von Waren und Dienstleistungen verschiedener Unternehmen taugt.
Nicht schutzfähig sind nach § 3 Abs. 2 MarkenG jedoch Zeichen, die aus Formen oder anderen Merkmalen bestehen, die durch die Art der Ware selbst bedingt sind, die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich sind oder die der Ware einen wesentlichen Wert verleihen.

§ 3 MarkenG
(1) Als Marke können alle Zeichen, insbesondere Wörter einschließlich Personennamen, Abbildungen, Buchstaben, Zahlen, Klänge, dreidimensionale Gestaltungen einschließlich der Form einer Ware oder ihrer Verpackung sowie sonstige Aufmachungen einschließlich Farben und Farbzusammenstellungen geschützt werden, die geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden.
(2) Dem Markenschutz nicht zugänglich sind Zeichen, die ausschließlich aus Formen oder anderen charakteristischen Merkmalen bestehen,
- die durch die Art der Ware selbst bedingt sind,
- die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich sind oder
- die der Ware einen wesentlichen Wert verleihen.
Bei Unionsmarke: Unionsmarkenverordnung
Wie bereits oben darleget, besteht auch die Möglichkeit, ein Zeichen als Unionsmarke (durch Eintragung bei der EUIPO) schützen zu lassen. Rechtsgrundlage der Unionsmarke ist die Unionsmarkenverordnung (UMV) vom 14. Juni 2017 (Verordnung [EU] 2017/1001). Diese verläuft mit Blick auf Ihren Regelungsgehalt nahezu parallel zum deutschen Markengesetz, so dass mit Blick auf die Schutzfähigkeit von Zeichen auf das oben Gesagte verwiesen werden kann, wenngleich der normative Anknüpfungspunkt Art. 4 UMV ist.
Unionsmarke: Grundsatz der Einheitlichkeit
Bei der Eintragung einer Unionsmarke ist jedoch der Grundsatz der Einheitlichkeit nach Art. 1 Abs. 2 UMV zu berücksichtigen. Dieser schreibt vor, dass die Unionsmarke einheitlich ist. Das bedeutet, dass sich Schutzvoraussetzungen, Wirkung und Schranken stets auf das Gebiet der gesamten Europäischen Union erstrecken. Undenkbar ist also der Fall, dass der Inhaber einer Unionsmarke diese nur für ein bestimmtes Gebiet übertragen kann. Hat der Rechtsinhaber eine Unionsmarke eingetragen, so findet das nationale Markengesetz keine Anwendung. Es ist – zumindest im Grundsatz – allein auf die Unionsmarkenverordnung abzustellen (Art. 17 Abs. 1 S. 1 UMV).
Art. 17 UMV
(1) 1 Die Wirkung der Unionsmarke bestimmt sich ausschließlich nach dieser Verordnung. 2 Im Übrigen unterliegt die Verletzung einer Unionsmarke dem für die Verletzung nationaler Marken geltenden Recht gemäß den Bestimmungen des Kapitels X.
(2) Diese Verordnung lässt das Recht unberührt, Klagen betreffend eine Unionsmarke auf innerstaatliche Rechtsvorschriften insbesondere über die zivilrechtliche Haftung und den unlauteren Wettbewerb zu stützen.
(3) Das anzuwendende Verfahrensrecht bestimmt sich nach den Vorschriften des Kapitels X.
Verletzungstatbestände
Kern des Markenrechts ist ein sogenanntes Ausschließlichkeitsrecht (§ 14 Abs. 1 MarkenG bzw. Art. 9 Abs. 1 UMV). Dieses gewährt dem Rechteinhaber das grundsätzlich exklusive Recht, das geschützte Zeichen zu verwenden und Dritten die Verwendung zu untersagen. Voraussetzung hierfür ist jedoch, dass einer der in § 14 Abs. 2, 3 MarkenG oder Art. 9 Abs. 2, 3 UMV genannten Verletzungstatbestände erfüllt ist und eine Verwechslungsgefahr nach § 14 Abs. 2 MarkenG bzw. Art. 9 Abs. 2 UMV im konkreten Fall vorliegt.
Der Verwechslungsschutz
Einer dieser Tatbestände ist der Verwechslungsschutz. Dieser ist in § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG bzw. Art. 9 Abs. 2 lit. b) UMV geregelt.
Der Inhaber des Markenrechts kann einem Dritten insoweit verbieten, das Kennzeichen markenmäßig im geschäftlichen Verkehr für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, wenn das Zeichen mit der (Unions)Marke des Rechtsinhabers identisch oder ihr ähnlich ist und für Waren oder Dienstleistungen benutzt wird, die mit denjenigen identisch oder ihnen ähnlich sind, für die die (Unions)Marke eingetragen ist.
Dies allein genügt jedoch nicht, um Ansprüche des Rechteinhabers zu begründen. Vielmehr muss die Gefahr bestehen, dass Dritte das verwendete Zeichen mit der geschützten Marke gedanklich in Verbindung bringen. Das gedankliche Inverbindungbringen reicht jedoch für sich genommen nicht für eine Verletzungshandlung aus, wenn hierdurch nicht auch gerade eine Verwechslung beim Rezipienten möglich scheint.
Insgesamt gibt mit Blick auf § 14 Abs. 2 MarkenG und Art. 9 Abs. 2 lit. b) UMV drei denkbare Konstellationen des markenrechtlichen Verwechslungsschutzes.
Varianten des Verwechslungsschutzes:
| Marken | Waren / Dienstleistungen |
| identisch | identisch |
| identisch | ähnlich |
| ähnlich | identisch |
Im geschäftlichen Verkehr
Grundvoraussetzung eines jeden markenrechtlichen Verletzungstatbestandes ist jedoch, dass das Zeichen im geschäftlichen Verkehr verwendet wird. Diese Voraussetzung ergibt sich zum einen aus dem Gesetz selbst (§ 14 Abs. 2 MarkenG bzw. Art. 9 Abs. 2 UMV), zum anderen aber auch aus der Eigenart des Markenrechts als gewerbliches Schutzrecht. Ein Dritter verwendet das Zeichen im geschäftlichen Verkehr dann, wenn die Benutzung in einem ursächlichen Zusammenhang mit einer auf wirtschaftliche Vorteile gerichteten kommerziellen Tätigkeit beruht und nicht allein im privaten Bereich erfolgt (Mielke, in: Kur/v. Bomhard/Albrecht, BeckOK MarkenR, 28. Edition, § 14 Rn. 57).
Voraussetzung ist demnach, dass die Benutzung des Zeichens einem eigenen oder fremden Geschäftszweck dient (BGH GRUR 2004, 241 f.). Die Anforderungen an das Vorliegen des Kriteriums „im geschäftlichen Verkehr“ sind jedoch nicht allzu hoch. Vielmehr sind die Hürden gering. Es kommt dabei weder auf eine Gewinnerzielungsabsicht noch eine Entgeltlichkeit der vom Verwender angebotenen Dienstleistungen und Waren an.
Verwechslungsgefahr im Markenrecht: 3-stufigkeit
Ist diese Hürde genommen, so kommt es für die Frage, ob eine Markenrechtsverletzung im konkreten Fall vorliegt, darauf an, ob die von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG bzw. Art. 9 Abs. 2 lit. b) UMV verlangte Verwechslungsgefahr im Markenrecht vorliegt. Hierbei ist in einem Dreischritt zu prüfen. Ob eine Verwechslungsgefahr vorliegt ist durch Würdigung aller Umstände des Einzelfalls zu ermitteln, wobei die Kennzeichnungskraft der geschützten Marke, die Identität oder der Grad an Ähnlichkeit der verwendeten Zeichen sowie die Identität oder der Grad an Ähnlichkeit der betroffenen Waren oder Dienstleistungen zu erforschen sind.
Hierbei ist auf den verständigen Verbraucher und dessen berechtigte Erwartungen an die Marke abzustellen.
Kennzeichnungskraft
Ausgangspunkt der Prüfung bildet der Grad der Kennzeichnungskraft derjenigen Marke, auf die sich der Rechteinhaber stützt. Maßgeblich hierfür ist die Verkehrsauffassung. Dabei unterscheidet die Rechtsprechung zwischen verschiedenen Graden an Kennzeichnungskraft. Es wird unterschieden zwischen „sehr hoher“, „hoher“, „normaler“, „geringer“ und „sehr geringer“ Kennzeichnungskraft. Die Einordnung der betroffenen Marke in eine dieser Kategorien dient vor allem der Bestimmung des Schutzumfangs
Eine Marke mit hoher Kennzeichnungskraft kann damit grundsätzlich einen höheren Schutzumfang für sich beanspruchen, als eine Marke mit geringer Kennzeichnungskraft.
Identität und Ähnlichkeit von Ware und Dienstleistung
In einem weiteren Schritt sind die von den streitenden Parteien im geschäftlichen Verkehr angebotenen Waren oder Dienstleistungen miteinander zu vergleichen. Dabei ist die Verwechslungsgefahr im Markenrecht besonders hoch, wenn die angebotenen Waren oder Dienstleistungen identisch sind. Sind diese hingegen nur ähnlich, dann muss ermittelt werden, wie hoch der Grad der Ähnlichkeit ist.
Identität und Ähnlichkeit der Kennzeichen
Ebenfalls auf die Identität bzw. den Grad der Ähnlichkeit hin zu untersuchen sind die verwendeten Kennzeichen. Dabei muss das geschützte Markenkennzeichen mit dem benutzten Kennzeichen des vermeintlichen Verletzers verglichen werden.
Auch insoweit kann zwischen „sehr hoher“, „hoher“, „normaler“, „geringer“ und „sehr geringer“ Zeichenähnlichkeit unterschieden werden.
Dabei kann zwischen der klanglichen, bildlichen bzw. schriftbildlichen und der begrifflichen Verwechslungsgefahr unterschieden werden.
Insbesondere gilt bei Wortmarken der Grund- bzw. Erfahrungssatz, dass Wortanfänge durch das Publikum und die Adressaten des Zeichens stärker betrachtet werden, als die nachfolgenden, gegebenenfalls bloß beschreibenden Wortbestandteile.

⇒ Begriffliche Verwechslungsgefahr
Eine begriffliche Verwechslungsgefahr im Markenrecht liegt immer dann vor, wenn den beiden verwendeten Kennzeichen dieselbe Sinnwirkung zukommt. Für das Vorliegen einer begrifflichen Verwechslungsgefahr nicht notwendig ist es jedoch, dass es sich um dieselbe Art von Marke handelt (z.B. zwei Bild- oder zwei Wortmarken). Vielmehr kann eine solche begriffliche Verwechslungsgefahr im Markenrecht auch dann vorliegen, wenn die geschützte Marke eine Wortmarke und das angegriffene Zeichen eine Bildmarke oder andersherum ist.
⇒ Klangliche Verwechslungsgefahr
Auch eine klangliche Identität oder Ähnlichkeit der Zeichen kann eine Verwechslungsgefahr im Markenrecht im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG begründen. Diese liegt dann vor, wenn sich die gegenüberstehenden Marken in der Vokalfolge, der Silbenzahl oder im Klangrhythmus sehr nahekommen.
⇒ Bildliche und schriftbildliche Verwechslungsgefahr
Eine Verwechslungsgefahr im Markenrecht kann auch dann vorliegen, wenn das Schriftbild oder das Bild der verwendeten Kennzeichen identisch oder ähnlich ist. Auch hierbei kommt es auf den Gesamteindruck an, den der durchschnittliche Verbraucher von den verwendeten Zeichen hat.
Ihre Fachanwaltskanzlei für gewerblichen Rechtsschutz
Als Fachanwalt für Gewerblichen Rechtsschutz berate und vertrete ich gemeinsam mit meinem Team seit Jahren Unternehmen bei allen Fragen rund um das Markenrecht. Wir verfügen über die notwendige Erfahrung im Umgang mit markenrechtlichen Abmahnungen, einstweiligen Verfügungsverfahren, Klageverfahren sowie Widerspruchsverfahren. Wir schützen Ihre Marke und begleiten Sie angefangen bei der Markenkonzeption bis hin zur dauerhaften Markenüberwachung.
Kontaktieren Sie uns gern in allen markenrechtlichen Fragen. Wir vertreten Sie bundesweit.
Titelbild: © MR/ AdobeStock
Beitragsbild 1: © FR Design/ AdobeStoc
Beitragsbild 2: © Nuthawut/ AdobeStock