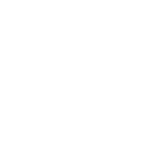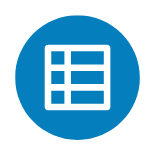UPDATE: Verwertungsgesellschaft GEMA verklagt OpenAI
ChatGPT nutzt durch das Generieren der KI laut der GEMA urheberrechtlich geschützte Songtexte ohne Lizenz.
Klage der GEMA
Die GEMA hat im November 2024 Klage gegen OpenAI erhoben. OpenAI ist das US-amerikanische Unternehmen, welches sich hinter der künstlichen Intelligenz „ChatGPT“ verbirgt. ChatGPT ist ein überaus fähiges System, welches chat-basiert Antworten auf Fragen aus allen Lebensbereichen gibt, aber auch vielseitig andere Dinge erledigen kann. Dazu gehören Logikaufgaben, aber auch beispielsweise komplexe Planung.
Konkret möchte die GEMA mit diesem Prozess nachweisen, dass sich ChatGPT an der Datenbank der GEMA bedient, um die genutzten Songtexte als Antwort geben zu können. Die GEMA wirft OpenAI konkret vor, unlizenziert die Songtexte im Chatbot wiederzugeben.
ChatGPT nutze die Songtexte, ohne die Urheber der Werke bzw. der GEMA angemessene Lizenzgebühren zu zahlen.
Argumente der GEMA
Die GEMA begründet ihr Vorgehen damit, dass ChatGPT keinen Vorrang zu anderen Diensten habe. Das KI-Programm müsse genauso wie andere Unternehmen Lizenzgebühren zahlen, um die urheberrechtlich geschützten Songs (und ihre Texte) zu verwenden.
Die GEMA hat als Reaktion eine interne „KI-Charta“ mit 10 Kernprinzipien erstellt, mit der klargemacht werden soll, dass die Songtexte keine Gratisressource seien. Unter anderem fordert die GEMA darin Schutz des geistigen Eigentums und „digitalen Humanismus“, sowie Respekt für die Persönlichkeitsrechte.
Ebenfalls hat die GEMA ein Lizenzmodell für KI-Programme wie ChatGPT erstellt. Ziel sei, auch bei KI-Anwendungen faire Bedingungen für die Urheber der Werke zu schaffen, so dass über die „Primärnutzung“ hinaus Urheber und Urheberrinnen auch an der späteren Generierung der Inhalte beteiligt werden müssten.
Rechtliche Einordnung in das Urheberrecht
Das Urheberrecht schützt Musikwerke. Sie sind ausdrücklich als eine der geschützten Werke in § 2 Nr. 2 UrhG normiert.
Songtexte sind in der Regel auch vom Urheberrecht geschützt. Sie sind getrennt von den Musikwerken zu betrachten. Sie sind Teil der Sprachwerke, die in § 2 Nr. 1 UrhG normiert werden. Sie werden dort nicht namentlich erwähnt, gehören aber nach herrschender Auffassung zu den geschützten Werken.
In der Theorie muss im Einzelfall überprüft werden, ob der Liedtext genügend sogenannte sog. Schöpfungshöhe aufweist. Dies bedeutet, dass eine künstlerische Leistung vorliegen muss, damit der Liedtext urheberrechtlichen Schutz genießt. Dies ist aber in der Regel der Fall, da die „Kleine Münze“, ein die Schöpfungshöhe nach unten abgrenzendes rechtliches Konzept, die Schwelle niedrig hält. Liedtexte genießen also den gleichen Schutz wie die Melodie des Songs, solange sie eine genügend hohe Schöpfungshöhe aufweisen.
Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass die Nutzung von Musikwerken oder deren Texte (Lyrics) nur mit einer Lizenz (Nutzungserlaubnis) möglich ist.
Die Rechte zum Nutzen der geschützten Werke werden im Urheberrecht Verwertungsrechte genannt. Verwertungsgesellschaften wie die angesprochene GEMA haben Verträge mit den Künstlern und kümmern sich für sie um die Lizenzvergabe.
UPDATE: November 2025
Im laufenden Verfahren vor dem Landgericht München I (Az. 42 O 14139/24) hat die 42. Zivilkammer am 11. November 2025 ein wegweisendes Urteil gefällt: Nach Überzeugung des Gerichts hat OpenAI für Training und Betrieb von ChatGPT urheberrechtlich geschützte Liedtexte aus dem GEMA-Repertoire ohne die erforderlichen Lizenzen genutzt.
Umfang der beanstandeten Nutzung
Im Verfahren wurde festgestellt, dass mindestens neun bekannte deutsche Titel betroffen waren – unter anderem „Atemlos“, „Männer“ und „Über den Wolken“. Die Songtexte waren in den Ausgaben des Chatbots in Teilen nahezu wortgleich reproduziert worden. Entscheidend war für das Gericht nicht allein die Wiedergabe, sondern die technische Funktionsweise: Um solche nahezu identischen Outputs erzeugen zu können, müssen die Texte zuvor im Trainingsprozess vollständig verarbeitet und als Datenbestand gespeichert worden sein.
Damit lag nach Ansicht der Kammer nicht nur ein „Lesen“ der Werke vor, sondern eine urheberrechtlich relevante Vervielfältigung (§ 16 UrhG). Die spätere Bereitstellung solcher Inhalte über ChatGPT erfüllt darüber hinaus die öffentliche Zugänglichmachung (§ 19a UrhG). Beide Nutzungshandlungen bedürfen zwingend einer Lizenz – die nach den Feststellungen des Gerichts nicht vorlag.
Rechtliche Einordnung durch das Gericht
Das Landgericht hat ausdrücklich hervorgehoben, dass KI-Systeme keinen Sonderstatus genießen. Auch wenn maschinelles Lernen technisch bedingt auf große Datenmengen angewiesen ist, bleibt die Nutzung geschützter Werke an die Regeln des Urheberrechts gebunden. Das Gericht stellte daher klar:
- Das bloße „technische Erfordernis“ des KI-Trainings rechtfertigt keinen Eingriff in urheberrechtliche Positionen.
- Der KI-Entwickler trägt die Verantwortung dafür, dass geschützte Inhalte nur mit Erlaubnis genutzt werden.
- Die Verarbeitung geschützter Werke im Trainingsdatensatz ist rechtlich nicht privilegiert und stellt eine vollwertige Nutzung im Sinne des Urheberrechts dar.
Besonders betont wurde, dass KI-Modelle, die geschützte Inhalte nahezu unverändert ausgeben können, zwangsläufigzuvor urheberrechtlich geschützte Inhalte vervielfältigt haben müssen.
Bedeutung für den europäischen Rechtsrahmen
Die Entscheidung wird in der Fachwelt als Signal an die gesamte europäische KI-Branche verstanden. Sollte das Urteil rechtskräftig werden, dürfte es die Linie vorgeben, dass KI-Anbieter künftig vor der Aufnahme geschützter Werke in Trainingsdaten entsprechende Lizenzen einholen müssen – ähnlich wie andere Unternehmen, die Werke vervielfältigen oder öffentlich zugänglich machen.
Dies hätte weitreichende praktische Folgen: KI-Entwickler müssten Lizenzmodelle entwickeln oder bestehende Verwertungsgesellschaften – wie die GEMA – in ihre Geschäftsmodelle integrieren. Gleichzeitig stärkt das Urteil die Position von Urhebern und Rechteinhabern gegenüber globalen Technologieanbietern.
Verfahrensstand
Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. OpenAI hat die Möglichkeit, Berufung zum OLG München einzulegen. Angesichts der Grundsatzrelevanz ist davon auszugehen, dass der Rechtsstreit nicht nur auf nationaler Ebene, sondern langfristig möglicherweise auch europäisch weitergeführt wird.
Fazit
Daraus ergibt sich, dass auch KI-Anwendungen nicht ohne weiteres urheberrechtlich geschützte Werke, hier Sprachwerke in Form der Liedtexte nutzen dürfen. Durch das Generieren der Liedtexte als Antwort liegt auf der Hand, dass die Sprachwerke bereits in der OpenAI-Datenbank sein müssen.
Durch die Verwertung von OpenAI könnten somit die Urheberrechte der Künstler und der GEMA verletzt werden.
Nehmen Sie gerne Kontakt zu uns über kontakt@gessner-legal.de auf.